Forschungsprojekt des Universitätsklinikums Freiburg entwickelt tierversuchsfreies Verfahren zur Sicherheitsbeurteilung moderner Krebstherapien
Mitteilung: Universitätsklinikum Freiburg
Wissenschaftler*innen des Universitätsklinikums Freiburg haben im Rahmen der britischen „Crack it“– Challenge eine Förderung von einer Million Pfund erhalten, umgerechnet rund 1,17 Millionen Euro. Das Team unter der Leitung von Prof. Dr. Toni Cathomen, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie am Universitätsklinikum Freiburg, erforscht einen innovativen Ansatz in der Sicherheitsbeurteilung moderner Krebstherapien. Die neue Methode soll helfen, Tierversuche zu ersetzen und die Sicherheit der sogenannten CAR-T-Zelltherapie zu verbessern. Das „Crack it“-Challenge-Förderprogramm wird jährlich von der britischen Forschungsorganisation NC3Rs mit maximal einer Million Pfund ausgeschrieben und hat das Ziel, Tierversuche zu reduzieren.
Tierfreie Forschung für sicherere Behandlungen
„Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der Crack it – Challenge diese umfangreichen Fördermittel erhalten haben. Diese Unterstützung ermöglicht es uns, echte Pionierarbeit in der Krebsforschung zu leisten“, sagt Cathomen. Die neuartige Methode soll mithilfe von künstlicher Intelligenz Biomarker für die Sicherheit von CAR-T-Zellen ermitteln. Die Kombination und Einteilung dieser Marker soll eine präzisere Vorhersage und Sicherheitsbeurteilung der Zelltherapie ermöglichen.
„Um die Behandlung von Krebspatient*innen zu verbessen, bedarf es der Forschung nach neuen Ansätzen und Methoden. Die Förderung bestätigt die Kompetenz des Universitätsklinikums Freiburg auf dem Gebiet der Krebsmedizin und das Bestreben sie ständig weiterzuentwickeln“, sagt Prof. Dr. Lutz Hein, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg und Vorstandsmitglied des Universitätsklinikums Freiburg.
Körpereigene Immunzellen im Labor gegen den Krebs schulen
CAR-T-Zelltherapien werden bereits bei zahlreichen Krebserkrankungen eingesetzt und bieten ein großes Potenzial für die Behandlung von Patient*innen mit bisher unheilbaren Krebserkrankungen. Dafür werden den Patient*innen körpereigene Abwehrzellen (T-Zellen) entnommen und im Labor so verändert, dass sie Krebszellen zielgerichtet erkennen und bekämpfen. Um die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen und Komplikationen dieser modernen Behandlungsmethode zu minimieren, besteht weiterhin Forschungsbedarf. Bisherige tierexperimentelle Studien sind invasiv und fordern eine lange Studiendauer. „Wir hoffen, mit unserer Forschung einen wichtigen Beitrag für eine möglichst sichere und individuell zugeschnittene Behandlung von Krebspatient*innen leisten zu können. Die ersten Ergebnisse der Studie erwarten wir in zwei Jahren“, sagt Cathomen.
5.2.2024
Universitätsklinikum Freiburg
www.uni-freiburg.de


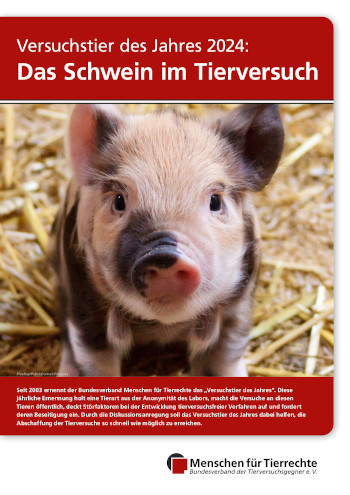
 Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts waren sich Forschende einig: Hohe Intelligenz braucht die hohe Rechenkapazität großer Gehirne. Zudem fand man heraus, dass die typische Hirnrinde der Säugetiere, der sogenannte Kortex, notwendig ist, um damit Informationen detailliert zu analysieren und zu verknüpfen. Vogelgehirne sind jedoch sehr klein und besitzen keine Struktur, die einem Kortex ähnelt. Dennoch konnten Wissenschaftler*innen zeigen, dass Papageien und Rabenvögel in die Zukunft planen, soziale Strategien schmieden, sich im Spiegel erkennen und Werkzeuge bauen. Sie sind somit Schimpansen ebenbürtig. Auch weniger begabte Vögel, wie zum Beispiel Tauben, lernen orthographische Regeln, mit denen sie Tippfehler in kurzen Worten erkennen oder Bilder nach Kategorien wie „Impressionismus“, „Wasser“ oder „von Menschen gemacht“ ordnen. Wie ist das möglich? Wie schaffen sie das mit so kleinen Gehirnen und ohne Kortex? Mit ihrem Beitrag in Trends in Cognitive Science kommen Prof. Dr. Onur Güntürkün, Dr. Roland Pusch und Prof. Dr. Jonas Rose der Lösung dieses über hundert Jahre alten Rätsels näher.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts waren sich Forschende einig: Hohe Intelligenz braucht die hohe Rechenkapazität großer Gehirne. Zudem fand man heraus, dass die typische Hirnrinde der Säugetiere, der sogenannte Kortex, notwendig ist, um damit Informationen detailliert zu analysieren und zu verknüpfen. Vogelgehirne sind jedoch sehr klein und besitzen keine Struktur, die einem Kortex ähnelt. Dennoch konnten Wissenschaftler*innen zeigen, dass Papageien und Rabenvögel in die Zukunft planen, soziale Strategien schmieden, sich im Spiegel erkennen und Werkzeuge bauen. Sie sind somit Schimpansen ebenbürtig. Auch weniger begabte Vögel, wie zum Beispiel Tauben, lernen orthographische Regeln, mit denen sie Tippfehler in kurzen Worten erkennen oder Bilder nach Kategorien wie „Impressionismus“, „Wasser“ oder „von Menschen gemacht“ ordnen. Wie ist das möglich? Wie schaffen sie das mit so kleinen Gehirnen und ohne Kortex? Mit ihrem Beitrag in Trends in Cognitive Science kommen Prof. Dr. Onur Güntürkün, Dr. Roland Pusch und Prof. Dr. Jonas Rose der Lösung dieses über hundert Jahre alten Rätsels näher.